Beispiel 1: „Wo kommst du her?“
Als Studienanfängerin fuhr ich in eine andere Stadt, um an einem Workshop teilzunehmen. Bevor das Programm begann, unterhielt ich mich angeregt mit einer anderen Teilnehmerin. Sie hatte einen Namen, den ich nie zuvor gehört hatte. „Wo kommst du her?“, fragte ich neugierig. Sie runzelte die Stirn und sagte: „Aus meiner Mutter!“ Für den Rest des Tages ging sie mir aus dem Weg.
„Andere“ Perspektiven
Einige Jahre später, als ich anfing, Texte deutschsprachiger Autor*innen of Color zu lesen, verstand ich, dass die Frage „Wo kommst du her?“ ein Klassiker unter den rassistischen Verletzungen ist. Die Poetry-Slammerin Yasmin Hafedh schildert auf der Bühne, wie ein nettes Gespräch zu einem unangenehmen Verhör wird, wenn sich ihr Gegenüber weigert, ihre Antwort „Aus Wien!“ zu akzeptieren. Der Autor Mutlu Ergün (heute Mutlu Ergün-Hamaz) bietet in „Kara Günlük: Die geheimen Tagebücher des Sesperado“ eine Liste seiner persönlichen „fünf besten Antworten auf die kolonial gefärbte Frage ,Wo kommst du her?‘“. Die Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette bat in einem ihrer Workshops Schwarze und Teilnehmer*innen of Color darum, Sätze aufzuschreiben, die sie nie wieder hören wollen. „Wo kommst du her?“ gehörte für mehr als ein Viertel der Anwesenden zu diesen Sätzen. Eindrücklich erklärt Ogette, wie diese Frage sie seit ihrer Kindheit immer wieder verletzt hat:
„Ich selbst bin in Leipzig geboren. Ich sprach Deutsch wie alle, dachte und träumte in Deutsch, aß gern Leipziger Allerlei und konnte bei Bedarf einen phänomenalen sächsischen Dialekt hinlegen. Leipzig war meine Heimat. Die Menschen außerhalb meiner Familie, im Kindergarten, auf der Straße, in der Straßenbahn, sahen das anders. Ständig und immer wieder suggerierten sie – mal mehr und mal weniger subtil –, dass ich nicht so aussah, wie man hier aussieht, und ergo nicht von hier sein konnte. Unzählige Male wurde ich gefragt, wo ich denn WIRKLICH herkam, was für eine ,Mischung’ ich war, wo meine Wurzeln liegen und ob ich denn nicht mal wieder zurück wolle. Ich wurde für mein gutes Deutsch gelobt. Im Gymnasium, später in Berlin, sollte ich im Geschichtsunterricht über meine Heimat erzählen. ,Also in Leipzig…’, fing ich an. ‚Nein’, sagte die Lehrerin mit ernstem Blick, ,Deine richtige Heimat, im Busch.’“ (Ogette 2020, S. 99).
Seit ich solche Erfahrungsberichte und Analysen von Schwarzen und Expert*innen of Color kenne, denke ich immer nach, bevor ich einer anderen Person diese Frage stelle. Denn mittlerweile weiß ich, dass sie in manchen Situationen ein großes Verletzungspotenzial hat.
Weiße Privilegien und rassistische Sprache
Ohne diese Frage aufzuwachsen, ist ein Privileg von vielen, das ich aufgrund meines Weißseins habe. Während Rassismus Schwarze Menschen und People of Color benachteiligt, verschafft er weißen Menschen unfaire Vorteile (Sow 2009). Rassismusforscher*innen und Aktivist*innen beschäftigen sich sowohl mit der Frage, welche Folgen Rassismus für Schwarze und People of Color hat, als auch mit der Funktionsweise weißer Privilegien. Eine anschauliche Liste dieser Privilegien hat Peggy McIntosh bereits im Jahr 1988 veröffentlicht. Ein bedeutsames weißes Privileg ist die Freiheit, sich bewusst für (oder eben gegen) eine Auseinandersetzung mit Rassismus entscheiden zu können. Schwarze und People of Color haben diese Wahl nicht – sie erleben rassistische Benachteiligung und sind gezwungen, sich damit zu beschäftigen.
Beispiel 2: „Das war rassistisch!“
Neben meinem Studium arbeitete ich ehrenamtlich in der Redaktion einer politischen Jugendzeitschrift. Eine unserer Ausgaben widmete sich dem Thema „(Neo-)Kolonialismus“, und ich schrieb den Leitartikel. Ich steckte viel Zeit und Energie in die Recherche und den Schreibprozess. Als der Text endlich fertig war, lobten die anderen Redaktionsmitglieder ihn in den höchsten Tönen. Nach der Veröffentlichung erhielt ich eine wütende E-Mail von einem Bekannten. Er warf mir vor, mein Leitartikel enthalte rassistische Begriffe. Die kritisierten Begriffe hatte ich bisher immer als neutral betrachtet, ich hatte im Studium wissenschaftliche Definitionen dafür gelernt und benutzte sie seit Jahren – wie viele andere Menschen in meinem Umfeld. Noch nie zuvor war ich dafür kritisiert worden.
Zuerst reagierte ich empört, hielt die Kritik für übertrieben, ärgerte mich über den wütenden Ton in der E-Mail meines Bekannten. Auf meinen Ärger folgte Enttäuschung – ich hatte mir so viel Mühe gegeben mit meinem Text, und statt Anerkennung bekam ich Vorwürfe. Auf die Enttäuschung folgte das Nachdenken. Hatte mein Kritiker wirklich unrecht?[3]
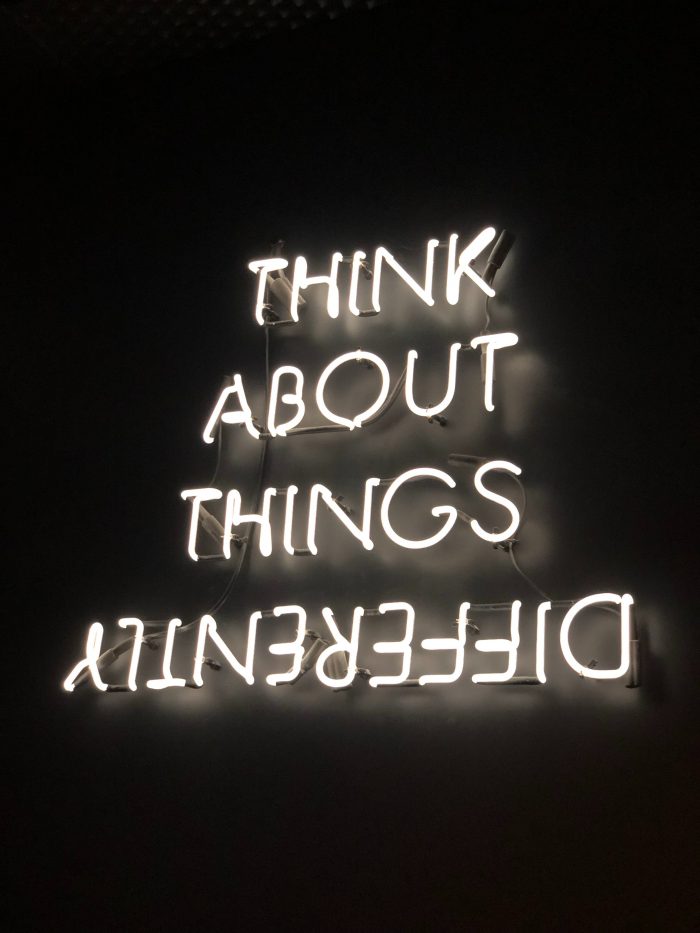
Rassistisches Wissen ist fester Bestandteil des deutschen Bildungs- und Kulturkanons. Viele große Denker der Aufklärung – Hegel, Kant, Rousseau – verbreiteten koloniale, rassistische und antisemitische Ideen. Diese Aspekte ihrer Schriften werden heute jedoch meist verschwiegen oder bagatellisiert (Ayim et al. 2016, S. 33–42; Ogette 2020, S. 33-43).
Als Pädagogin und Autorin versuche ich, mich von dieser kolonialrassistischen Tradition zu emanzipieren. Ein Element dieser Emanzipation ist ein bewusster Umgang mit Sprache. Ich selbst entscheide, nach bestem Wissen und Gewissen, welche Worte ich verwende. Mein Anspruch ist, rassistische Begriffe zu vermeiden und Alternativen zu finden, die meinen Respekt vor der Würde aller Menschen zum Ausdruck bringen. Das Verständnis davon, welche Begriffe rassistisch sind, ist dabei ein Ergebnis kontroverser gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Auch – und besonders – Worte, die viele Menschen „schon immer“ verwendet haben, können Ausdruck von tief verwurzeltem Rassismus sein.[4] Deshalb nehme ich Kritik an meiner Wortwahl und meinem Handeln ernst, auch wenn ich sie nicht immer auf Anhieb nachvollziehen kann.
Handlungsoptionen im Rahmen pädagogischer Arbeit
Der Rassismusforscher und Lehrer Karim Fereidooni betont, dass es nicht darum geht, in der Auseinandersetzung mit weißen Menschen „Rassismuskritik (…) als Waffe (…) einzusetzen, um Unterordnung zu verlangen. Vielmehr bin ich der Meinung, dass sich alle Menschen mit Rassismus beschäftigen sollen, weil jede Person von Rassismus betroffen ist, zwar in einer qualitativen Unterschiedlichkeit, aber jede Person sollte sich fragen: Was hat Rassismus mit meinem eigenen Leben zu tun?“ (Fereidooni 2019, S. 8–9).
[J]ede Person sollte sich fragen: „Was hat Rassismus mit meinem eigenen Leben zu tun?“
Beispiel 3: „Ein Konzept nur für Weiße“
Nach jahrelanger wissenschaftlicher und praktischer Auseinandersetzung mit Rassismus arbeite ich u.a. als Rhetorik-Trainerin für „Argumentationstrainings gegen Rechtspopulismus“. In meinen Workshops gebe ich Hintergrundinformationen zum Phänomen Rechtspopulismus sowie zu rhetorischen Strategien und führe viele praktische Übungen durch. In der Feedback-Runde eines solchen Workshops sagte ein Teilnehmer: „Ich fand es wirklich interessant… aber für meinen Alltag hilft mir das alles nicht. Die Rassisten sind sowieso nicht bereit, mir zuzuhören.“
Als Pädagogin ist es meine Aufgabe, Bildungsangebote so zu gestalten, dass alle Teilnehmer*innen die gleichen Lerngelegenheiten erhalten. Doch die Art und Weise, wie ich Workshops, Unterrichtsstunden, Seminare konzipiere, ist geprägt von meinem Wissen, meiner Erfahrung – in meinem Fall also auch von weißen Privilegien. Um trotz meiner eingeschränkten Perspektive professionell pädagogisch arbeiten zu können, brauche ich andere Perspektiven als Ergänzung. Glücklicherweise habe ich in meiner beruflichen Laufbahn die Gelegenheit, mit vielen verschiedenen Kolleg*innen of Color zusammenzuarbeiten. Von ihnen, genauso wie von Workshop-Teilnehmer*innen, die mir ihr Feedback geschenkt haben, konnte ich enorm viel lernen. Trotzdem ist es in einer von weißer Dominanz geprägten Gesellschaft immer wieder eine Herausforderung, pädagogische Konzepte zu entwickeln, die auch – und besonders – für Schwarze und People of Color respektvolle Angebote sind. Fragen, die dabei helfen können, sind zum Beispiel:
- Ist das ein Thema, das vorwiegend oder ausschließlich weiße Menschen interessiert? Wieso?
- Wer hat die Beschäftigung mit diesem Thema vorgeschlagen? Wer war dagegen? Wieso?
- Bedeutet eine Auseinandersetzung mit diesem Thema (z.B. Sklaverei, rassistische Gewalt, Wahlerfolge der AfD…) für Schwarze/People of Color eine besondere Belastung, weil es sie an eigene Erfahrungen von Diskriminierung erinnert? Was kann ich als Pädagog*in tun, um mit dieser Belastung sensibel umzugehen?
- Wer profitiert von dem Wissen, das in der Auseinandersetzung mit diesem Thema entsteht? Wer kann im eigenen Alltag etwas damit anfangen? Für wen ist es „unnützes Wissen“?
- Sind in den Materialien, die ich für mein pädagogisches Angebot verwende, Schwarze Menschen und People of Color (oder weitergehend: Frauen, Trans*Personen, Menschen mit Behinderung…) repräsentiert? Wenn ja, in welchen Rollen? Ist mir das auf Anhieb aufgefallen?
- Angenommen, die Zielgruppe meines Bildungsangebotes wären ausschließlich Schwarze Menschen und People of Color. Was würde ich an meinem Konzept ändern?
Als weiße Pädagog*innen in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft sind wir doppelt gefragt. Einerseits als Menschen, die nicht rassistisch handeln wollen: Wie alle weißen Menschen sind wir angehalten, unsere eigene rassistische Sozialisation zu hinterfragen, uns aktiv zum Thema Rassismus weiterzubilden und uns gegen Rassismus einzusetzen, wo immer wir ihn sehen können. Andererseits sind wir als Pädagog*innen Vorbilder und Autoritätspersonen, unser Verhalten hat besonderes Gewicht. Wir haben Einfluss darauf, welche Begriffe wir verwenden, welche Konzepte wir wie erklären, auf welche Expert*innen wir uns beziehen und welche Texte wir lesen (lassen). Wir können im Sprachunterricht ausschließlich die Bücher behandeln, die schon lange Teil des Kanons sind – oder wir können recherchieren, welche bedeutsamen Werke es von Schwarzen und People of Color gibt. Wir können im Philosophieunterricht Kants kolonialrassistische Schriften verschweigen – oder sie zum Ausgangspunkt nehmen, um die Beziehung zwischen Politik und Philosophie zu beleuchten. Eine rassismuskritische Perspektive zu entwickeln, ist eine Menge Arbeit. Aber es ist eine riesige Chance, den Handlungsspielraum zu erweitern – für andere und für uns selbst.
Wir müssen über Rassismus und weiße Privilegien noch viel lernen. Unsere Schüler*innen, Student*innen, Klient*innen, Kolleg*innen und Freund*innen können uns auf diesem Weg begleiten. Viele von ihnen können uns eine ganze Menge beibringen. Wir können lernen, ihnen zuzuhören.
Mitarbeit: Katharina Schramm (Universität Bayreuth)
veröffentlicht am 21.10.2020
Literaturverzeichnis
Arndt, Susan/Ofuatey-Alazard, Nadja (2019). Wie Rassismus aus Wörtern spricht – (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Münster: Unrast.
Arndt, Susan/Eggers, Maureen Maisha/Kilomba, Grada/Piesche, Peggy (Hrsg.) (2005). Mythen, Masken und Subjekte – Kritische Weißseinsforschung in Deutschland. Münster: Unrast.
Ayim, May/Oguntoye, Katharina/Schultz, Dagmar (2016). Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Berlin: Orlanda.
Ergün, Mutlu (2016). Kara Günlük – die geheimen Tagebücher des Sesperado. Münster: Unrast. Online-Ausschnitt: https://www.youtube.com/watch?v=rFYIu4WYJ7A [Zugriff: 15.10.2020]
Fereidooni, Karim (2019). Rassismuskritik für Lehrer*innen und Peers im Bildungsbereich. Zwei Praxisbeispiele aus dem Schulunterricht. Online: https://schwarzkopf-stiftung.de/rassismuskritik/ [Zugriff: 25.09.2020]
Hafedh, Yasmin (2014). Wo kommst du her? Videoaufzeichnung des Poetry Slam-Auftritts. Online: https://www.youtube.com/watch?v=9Zl3fNQmiCo [Zugriff: 10.09.2020]
McIntosh, Peggy (1988). White Privilege: Den unsichtbaren Rucksack auspacken. Deutsche Übersetzung online: http://sanczny.blogsport.eu/2012/10/01/white-privilege-den-unsichtbaren-rucksack-auspacken/ [Zugriff: 25.09.2020]
Ogette, Tupoka (2020). Exit Racism – rassismuskritisch denken lernen. Münster: Unrast.
Sow, Noah (2009). Deutschland schwarz weiß – der alltägliche Rassismus. München: Goldmann.
Einzelnachweise
- Um die koloniale Ausbeutung, Versklavung und Ermordung von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, brauchten die europäischen Kolonialherren eine passende Ideologie. So entstanden im Zeitalter der Aufklärung, in Wechselwirkung mit der Erforschung und Ausbeutung von kolonisierten Menschen, machtvolle wissenschaftliche „Rassetheorien“. Formal gesehen sind die meisten ehemaligen Kolonien heute unabhängige Staaten, „Rassetheorien“ wurden offiziell wissenschaftlich verworfen. Doch rassistische Strukturen und Ideologien leben weiter. Einen guten Einblick in die deutschsprachige Forschung zu Rassismus und Critical Whiteness bietet der Sammelband „Mythen, Masken und Subjekte – kritische Weißseinsforschung in Deutschland“ (Arndt et al. 2017).
- Die Autorin dankt Prof. Dr. Katharina Schramm, Universität Bayreuth, für die wissenschaftliche Beratung beim Verfassen des Artikels.
- Wie ich damals reagieren viele weiße Menschen auf Rassismuskritik zuerst mit emotionaler Abwehr. Diese Abwehrhaltung – und mögliche Wege, sie zu überwinden – beschreiben u. a. Noah Sow „Deutschland schwarz weiß“ (2018) und Tupoka Ogette „Exit Racism“ (2020).
- Einen Überblick über rassistische Begriffe und die Geschichten dahinter bietet das kritische Nachschlagewerk „Wie Rassismus aus Wörtern spricht – (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache“ von Susan Arndt und Nadja Ofuatey-Alazard (2018).



