Workshops gegen Rassismus sind zu einem wichtigen Angebot der politischen Bildungsarbeit geworden. Sie richten sich an Betroffene von Rassismus, um sie zu empowern, aber auch an weiße[1] Jugendliche, um sie für die rassistischen Strukturen, in denen sie leben und die sie eventuell unbewusst reproduzieren, zu sensibilisieren. Diese Sensibilisierung ist eine wichtige pädagogische Aufgabe, welche aber auch mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Immer wieder führt die Auseinandersetzung mit Rassismus bei einigen Weißen Jugendlichen zu Abwehrreaktionen und Relativierungen – was auch Whataboutism genannt wird.
Äußerungen, die als Whataboutism bezeichnet werden können, fallen beispielsweise, wenn in einer Diskussion um rassistische Diskriminierung im Alltag eine Weiße Person sagt: „Es gibt ja nicht nur den Rassismus von Menschen außerhalb von Deutschland, sondern auch untereinander, dass man so etwas hört wie: Boah, du bist ja richtig deutsch! Und dann denke ich mir: Ich bin ja auch in Deutschland.“ Oder: „Früher hießen ja Schokoküsse anders, aber davon kann man ja nicht angegriffen sein, wenn es um die Bezeichnung des Essens geht.“[2]

Whataboutism ist eine rhetorische Strategie, um vom eigentlichen Thema abzulenken und beispielsweise auf vermeintliche eigene Diskriminierungserfahrungen zu verweisen. Diese Strategie wird besonders von weißen Personen in der Auseinandersetzung mit Rassismus häufig angewendet. Céline Barry, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle bei Each One Teach One (EOTO e. V.), sagte in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit von ihrer Arbeit mit Opfern von rassistischer Diskriminierung: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Weiße Deutsche in Abwehrhaltung gehen, sobald das Wort Rassismus fällt. Sobald man von Rassismus spricht, stellen sich die Leute selbst als Opfer dar, das zu Unrecht beschuldigt wurde. […] Als Sozialwissenschaftlerin kann ich mir dieses Verhalten strukturell erklären. Es geht darum, die eigene Macht aufrechtzuerhalten. Weißen kommt es zugute, dass sie schneller aufsteigen oder dass es Women of Color gibt, die sich um ihre Kinder kümmern, während sie selbst Karriere machen.“
Die Wissenschaftlerin und Autorin Priscilla Layne fügt hinzu: „Für viele Menschen ist die Einsicht dieser Tatsache, dass sie selbst von strukturellem Rassismus profitieren, so unangenehm, dass sie die Thematik lieber verdrängen.“[3] Das zeigte sich auch in Workshops gegen Rassismus, die im Projekt RISE durchgeführt wurden. Eine wiederkehrende Beobachtung war die Schwierigkeit von einigen weißen Teilnehmer*innen, die Phänomene Rassismus und andere Formen der Diskriminierung zu unterscheiden oder eigene rassistische Aussagen und Einstellungen als solche zu erkennen. Ein eintägiger Workshop im Juni 2021 mit einer Gruppe FSJler*innen beschäftigte sich beispielsweise mit dem RISE-Film „Wir sind“[4]. Die Teilnehmenden waren zwischen 17 und 20 Jahren alt. Sie kamen zum Teil aus ländlichen Regionen und waren sich teilweise bekannt. Einige Teilnehmende hatten selbst Fluchterfahrungen gemacht.
In einer Diskussion über Macht, Privilegien und Othering fragten die Workshopleiter*innen, welche Beispiele oder Situationen den Teilnehmenden einfallen, in denen Macht eine Rolle spielt. Daraufhin meldete sich ein Teilnehmer, den wir hier Tobias nennen, zu Wort:
„Also ich wurde zum Beispiel, als ich im Flüchtlingsheim gearbeitet habe, als Nazi betitelt, nur weil ich deutsch bin. Also ich denke, es gibt nicht nur die eine Seite. Und ich habe Dal letztens gefragt, wo er herkommt, und da ist mir aufgefallen, das ist auch schon Teil von Alltagsrassismus.“
Es geht darum, die eigene Macht aufrechtzuerhalten. Weißen kommt es zugute, dass sie schneller aufsteigen [...].

Daraufhin widmete sich die Gruppe dem Spannungsverhältnis zwischen Neugier und rassistischer Sprache in Bezug auf die Frage „Woher kommst du?“. Ein Teilnehmer mit eigener Fluchterfahrung aus Afghanistan, den wir Karim nennen, schilderte:
„Ja, genau diese Frage: Wo kommst du eigentlich her? Meistens ist das ja Neugier und die Leute wollen es eigentlich nur wissen. Manchmal ist das gut, aber manchmal auch nervig. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich mich schon vorgestellt habe. Das kommt wirklich bei jeder neuen Person vor, ich bin immer noch neu hier, nach fünf Jahren. Das Gefühl des Angekommenseins ist einfach nicht da, wenn man immer wieder so angesprochen wird. Damit komme ich noch klar, aber was ist, wenn ich in zehn bis fünfzehn Jahren Kinder habe, und die zur Schule gehen und sie dann immer noch diese Frage hören?“
Einige Minuten später schauten die Teilnehmer*innen ein Video zu Alltagsrassismus, in dem drei Betroffene über diskriminierende Erfahrungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt berichten.[5] Karim und Dal, ein weiterer Teilnehmer mit Fluchterfahrung, sprachen im Anschluss an den Film darüber, wie unangenehm diese Schilderungen für sie seien und dass sie sich wünschten, gegen diese Diskriminierung vorgehen zu können. Daraufhin meldete sich Tobias erneut zu Wort: „Man muss aber auch sagen, die Deutschen haben auch den Ruf als Nazis weg, den werden wir auch nicht wegkriegen. Aber die wissen auch, dass die genauso Leute auch in ihrem Land haben, also Rassisten. Wir haben halt das Pech, dass wir den Nazihintergrund haben.“
In einer weiteren Situation stellt die Workshopleitung die Frage, ob die Verantwortung für die Aufarbeitung von Rassismus auch bei den Betroffenen liegen würde. Daraufhin äußerte sich Tobias erneut und vertrat die Meinung, dass die „verletzte Reaktion“ der Betroffenen von Rassismus Teil des Problems sei und man auch als betroffene Person „das Positive in einem Menschen“ (also dem Gegenüber) sehen sollte. Eine Teilnehmerin kritisierte Tobias für diese Aussage: „Da kann ich dir überhaupt nicht zustimmen, wenn du etwas Rassistisches sagst, egal wie du es meinst, ist es rassistisch. Es ist generell extrem unhöflich und schlimm, und nur weil ich es so nicht meinte, bedeutet das nicht, dass es weniger schlimm ist.“
„Wo kommst du eigentlich her […] Das Gefühl des Angekommenseins ist einfach nicht da, wenn man immer wieder so angesprochen wird.“ (Workshopteilnehmer Karim)
An diesem Beispiel zeigt sich, wie fest Whataboutism–Argumentationen in Orientierungs- und Erzählmustern verankert sind und vehement, wenn auch unbewusst, vertreten werden. Obwohl Tobias sowohl durch Workshopmaterialien als auch durch die geteilten Erfahrungen oder das Intervenieren anderer Workshopteilnehmer*innen die Anregung bekommt, seine Äußerung zu reflektieren, fällt es ihm nicht leicht, sich von den gelernten Whataboutism-Argumenten zu lösen, die die Funktion haben, sich selbst oder die eigene Gruppe (hier die Nationalität) zu entlasten.
Whataboutism in der pädagogischen Praxis
Um der Frage nachzugehen, wie man auf Whataboutism in Workshops der politischen Bildungsarbeit reagieren kann, kommen im Folgenden zwei pädagogische Referent*innen zu Wort. Dafür haben wir Nina und Charlotte, die bei RISE selbst Workshops gegen Rassismus umsetzten, interviewt. Gefragt wurden sie, wie man sich bereits in der Planung von Workshops auf Whataboutism einstellen könnte:
Nina: „Zum einen kann man gleich zu Anfang unterschiedliche Diskriminierungsformen thematisieren. Auf diesem Weg kann man vorbeugen, dass es in der Diskussion oder im Gespräch über Rassismus zum Thema wird, obwohl es eigentlich gerade um etwas anderes geht. Man sollte zudem den Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte erklären und deutlich machen, inwiefern Rassismus ein strukturelles Problem ist. Wir sind leider alle mit rassistischem Denken aufgewachsen und sozialisiert und das muss immer wieder bewusst hinterfragt werden. Man sollte vermitteln, dass es nicht darum geht, keine Fehler zu machen oder nicht auch mal solche Gedanken zu haben, sondern immer wieder aktiv daran zu arbeiten, diese Muster zu verlernen.“
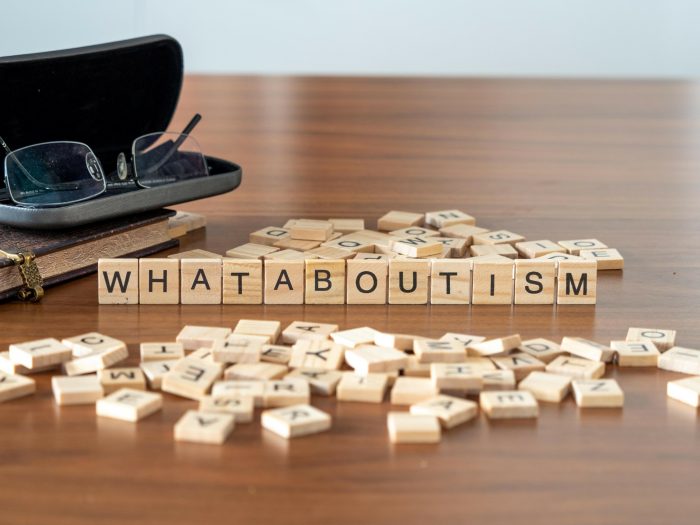
Zugleich ist es gerade in pädagogischen Kontexten wichtig, nicht jeden Einwurf vorschnell als Ausweichtaktik zu interpretieren. Denn zum einen beschreibt der Begriff Whataboutism zwar den argumentativen Versuch, eine gegnerische Position oder These durch einen Vergleich mit dem Verhalten des Gegners zurückzuweisen und auf seine Doppelmoral hinzuweisen. Zum anderen können solche Vergleiche von Jugendlichen aber auch darauf hindeuten, dass sie versuchen, sich in die Opfer von Diskriminierung hineinzuversetzen und ihre Perspektive einzunehmen. Wenn sie dabei nach eigenen Diskriminierungserfahrungen suchen und sie als Vergleich heranziehen, sollten sie in diesen legitimen Bemühungen nach Empathie auch unterstützt werden.
Charlotte: „Das Ernstnehmen finde ich auch wichtig. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass die unterschiedlichen Diskriminierungsformen nicht in Konkurrenz zueinander stehen oder irgendetwas schlimmer oder wichtiger ist als etwas anderes. Im Nachhinein glaube ich, dass der Grund, warum Whataboutism oft passiert, eine Art Schuldbewusstsein ist und dann dieser Reflex folgt: Aber ich erlebe doch auch Diskriminierung oder Ungerechtigkeit. Eine Möglichkeit wäre es, in Richtung Empowerment zu gehen und zu vermitteln: Es ist nicht deine Schuld, dass es Rassismus gibt, aber du kannst etwas daran ändern.“
Interviewerin: „Und welche Möglichkeiten würde es in den direkten Situationen geben, wenn man Whataboutism bemerkt, darauf zu reagieren?“
Nina: „Wenn es tatsächlich um andere Diskriminierungsformen geht, kann man kurz anmerken, dass es auch andere Diskriminierungsformen gibt und dass die auch ihren Raum haben müssen, aber dass jetzt gerade über Rassismus gesprochen wird und dass man beim Thema bleiben möchte. Und je nach Gruppe könnte man die Frage auch weitergeben: Was denken die anderen, warum wird gerade in dieser Situation abgelenkt? Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen, was die Ursachen für die Ablenkung sein könnten oder was für Gefühle vielleicht dazu führen.“
Charlotte: „Mir ist gerade eine Situation in einem Workshop eingefallen, wo ein Teilnehmer gesagt hat: ‚PoC haben über mich gelacht, weil ich nicht so gut Deutsch spreche.‘ Ich finde, man kann auch über dieses Opfer-Täter-Verhältnis sprechen und darüber, dass das eben nicht immer so klar ist. Die Unsicherheit, wer davon betroffen ist und wer nicht, macht die Diskriminierungsformen auch aus. Nur weil Menschen von Rassismus betroffen sind, heißt das nicht, dass sie nicht auch diskriminieren können, in einer anderen Form. Was ich außerdem noch wichtig finde, ist, deutlich zu machen, dass es einen Unterschied zwischen Mobbing und Diskriminierung gibt. Wenn also jemand von eindeutigen Mobbingerfahrungen berichtet, vorsichtig zu sagen: Das ist schlimm, aber das gehört nicht zwangsläufig in die Diskriminierungsformen. Das sollte man vielleicht noch mit im Hinterkopf haben.“
Whataboutism kann eine politische Abwehrstrategie sein, in der alltagsrassistische Denkschemata reproduziert werden. Allerdings ist nicht jeder Versuch, sich zu den Opfern von Diskriminierung in Beziehung zu setzen und entsprechende Vergleiche zu konstruieren, mit Whataboutism gleichzusetzen.
Daher ist es in pädagogischen Kontexten nicht nur wichtig, genau hinzuhören und den Beweggründen der sich äußernden Jugendlichen nachzuspüren, sondern sich auch methodisch auf mögliche Situationen vorzubereiten. Dafür stellt die RISE-Website u. a. Materialien zu unterschiedlichen Diskriminierungsformen und Privilegien bereit:
veröffentlicht am 02.08.2022
Einzelnachweise
- „"Weiß“" und „"Weißsein“" bezeichnen ebenso wie „"Schwarzsein“" keine biologische Eigenschaft und keine reelle Hautfarbe, sondern eine politische und soziale Konstruktion. Mit Weißsein ist die dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus gemeint, die sonst zumeist unausgesprochen und unbenannt bleibt. Nach: https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
- Diese Zitate sind direkte Zitate aus den Evaluationsworkshops für das Projekt RISE, der Artikel basiert auf einer Datenerhebung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des Projektes zwischen Mai und Dezember 2021.
- https://www.zeit.de/campus/2020-06/rassismusdebatten-deutschland-usa-talkshows-priscilla-layne-celine-barry?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
- https://rise-jugendkultur.de/produktion/wir-sind/ Der Film zeigt Interviews mit Menschen, die sich ganz unter-schiedlichen Gruppen, oder auch gar keiner, zugehörig fühlen, und von ihren persönlichen Ansichten und Erfahrungen erzählen.
- https://www.youtube.com/watch?v=ZdPk-vfD-iM




