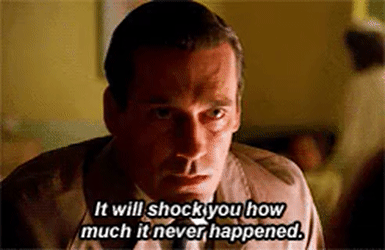Sind deutsche Medien islamfeindlich oder gar antimuslimisch? Die kurze Antwort heißt: Nein. Die etwas längere Antwort ist, dass die mediale Auseinandersetzung mit dem Islam in Deutschland genauso divers ist wie der Islam selbst. Zumal sich die gegenwärtige Berichterstattung über Muslim*innen¹ im Vergleich zu den 2000er-Jahren ausdifferenziert hat. Offenkundig antimuslimische Positionen, wie sie Rechtspopulist*innen vertreten, kommen im medialen Mainstream immer weniger vor. Trotzdem geschieht es nicht selten, dass Journalist*innen im Wettbewerb um Einschalt- und Lesequoten zu problematischen Schlagzeilen greifen – wie etwa beim Thementitel der ARD-Talkshow Maischberger „Sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam?“ oder dem FOCUS-Titel „Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Doch!“ Da bleibt Kritik eben nicht aus.
Gleichwohl stellen Medienwissenschaftler*innen wie Kai Hafez fest, dass Journalist*innen in den letzten Jahren mit verallgemeinernden Islambildern vorsichtiger umgehen und meist zwischen guten Muslim*innen und sogenannten Islamist*innen unterscheiden (wollen). Zwar sind heute noch negative Islambilder in den Medien zu finden, aber eben nicht nur. Ihnen werden oft Geschichten über gute Muslim*innen als leuchtende Gegenbeispiele entgegensetzt, eine Art Disclaimer. Häufig im gleichen Atemzug.
So gut diese Differenzierung zunächst klingt, so ist sie selbst nicht unproblematisch. So werden praktizierende Muslim*innen, Menschen aus muslimisch geprägten Familien und alle, die sich auf unterschiedlichste Weise mit dem Islam identifizieren, in zwei Gruppen geteilt: Auf der einen Seite stehen die „bösen“, auf der anderen Seite die „guten“ Muslim*innen. Letztere werden meist danach beurteilt, wie deutlich und wie oft sie sich von den Ersteren abgrenzen.
In dieser Teilung gelten Muslim*innen als das moralisch Verdächtige, und zwar so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. So ist es praktisch unmöglich, muslimische Identitäten jenseits von Gut und Böse zu denken. Medienwissenschaftler*innen nennen dieses Phänomen homogenisierendes Framing .
Dieses unterkomplexe, also vereinfachende Entweder-oder-Denken zieht sich durch die Debatte über muslimische Identitäten in Deutschland. Betroffenen wird damit vermittelt, sie müssen sich hier und jetzt entscheiden: Schwarz oder Weiß? Muslimisch oder Deutsch? Religiös oder liberal? Bikini oder Burkini? Fischer oder Capital Bra? Hier oder dort? Gehörst du eigentlich noch zu uns oder zu den anderen? Nun sag‘ es schon, in welche Schublade passt du? Die Fragen sind dir zu doof? Dann bist du damit nicht allein: MeTwo.
#MeTwo: Wer sind wir – und wenn ja, wie viele?
Im Sommer 2019 wurde der Hashtag #MeTwo auf Twitter ein Trend und löste damit eine breite Debatte über Rassismus in Deutschland aus. Unter dem Hashtag MeTwo („ich zwei“) twitterten mehrere Wochen lang Menschen mit Migrationsgeschichte darüber, was es heute heißt, in Deutschland Muslim*in und/oder Migrant*in zu sein bzw. als solche*r markiert zu werden. Was dabei herauskam, waren Beispiele für tausende Identitätsentwürfe von Menschen, die sich nicht in das Entweder-oder einfügen wollten. Ali Can, Initiator des Hashtags, sagte dazu:
„Warum 2? Weil ich mehr bin als nur eine Identität. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, habe hier Freunde und gehe hier arbeiten – und gleichzeitig kann ich mich auch zu einer anderen Kultur, einem anderen Land verbunden fühlen. Weil das Land mich beispielsweise geprägt hat, meine Eltern dort geboren sind oder ich die Sprache mag. Die zwei Seiten verschmelzen, stehen nicht im Widerspruch.”
— Ali Can
#MeTwo war eine Bestandsaufnahme von Rassismuserfahrungen, die sonst in Medienberichten kaum zur Sprache kommen. Diese reichten von Erfahrungen mit individuellem Rassismus, wie Witze über Essgewohnheiten oder verbale Anfeindungen im öffentlichen Verkehr, bis hin zu Erfahrungen mit institutionellem Rassismus, wie die Verweigerung einer Gymnasialempfehlung oder Absagen bei der Wohnungssuche.
Vor drei Tagen: Meine Mama erzählte mir, dass sie in der Bim von einem alten Mann attackiert wurde. Als meine Mutter auf türkisch telefonierte schrie dieser „Scheiß Türken. Raus hier. Scheiß Islam. Verpisst euch“ umadum. Dabei warf er eine Zeitung wütend auf den Boden #metwo
— Ömer Öztas (@Oztas_20) July 27, 2018
#MeTwo Die Lehrerin nimmt ein Börek aus meiner Pausenbrotbox und schreit:“ Ihhh esst ihr Fledermausflügel?“ Die Klasse lacht und ich vergesse es ein Leben lang nicht.
— GeeKay (@gkaynak) July 27, 2018
Auch wenn #MeTwo überwiegend den antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft sichtbar gemacht hat, nahmen nicht nur Muslim*innen an der Kampagne teil. Es haben sich daran auch Menschen beteiligt, die von anderen Rassismen betroffen sind: Afro-Deutsche, Menschen mit jüdischem Hintergrund, Sinti und Roma oder Kurd*innen. So wurde bei der Kampagne klar, dass sich Menschen über soziale Medien jenseits ihrer eigenen Communities vernetzen und solidarisieren können. Klar war jedoch auch, dass Deutschland, wie der Autor Imran Ayata schreibt, „sich extrem schwer damit tut, ein Land der Vielen zu sein“.
„Sie sind Türkin? Was sagen denn ihre Eltern zu ihrer Musik?“ #MeTwo0
„Und wieso tragen Sie kein Kopftuch, wenn Sie Muslimin sind?“#MeTwo
„Aleviten? Das sind doch Ungläubige und betreiben Inzest!“ #MeTwoHoch2
Dr. phil. Bitch Ray: #GermanDream #MyGermanDream— Lady Bitch Ray (@LadyBitchRay1) July 29, 2018
#MeinMoscheeReport: Das Subalterne kann twittern
#MeinMoscheeReport ist ein weiteres Beispiel einer erfolgreichen Twitter-Kampagne, die sich ebenso mit verzerrten Islamdarstellungen auseinandersetzt. Ausgelöst wurde die Debatte durch die ARD-Doku-Reihe Moscheereport, die nach ihrer Ausstrahlung für viel Kritik gesorgt hat. Kritiker*innen, vor allem aus muslimischen Communities, warfen den Macher*innen vor, ein einseitiges und vor allem skandalisierendes Bild von muslimischen Gotteshäusern zu reproduzieren. Unter dem Hashtag #MeinMoscheeReport teilten viele junge Muslim*innen ihre persönlichen Erfahrungen, Geschichten und Erinnerungen aus ihren Moscheebesuchen.
@ARDde @tagesschau Tut uns leid, Wir haben kurze Hand das Programm geändert. Heute läuft #meinmoscheereport und nicht #dermoscheereport
— Muhammed Suicmez (@msuicmez90) April 24, 2017
#meinmoscheereport nicht nur für das Gebet treffen, sondern auch der Ort wo wir uns entfalten können. Unser Jugendtreffpunkt! @rdic2
— Merve Aykız (@mervetas38) April 24, 2017
Die Debatte um #MeinMoscheeReport hat gezeigt, dass Moscheen im Besonderen und muslimische Räume im Allgemeinen in der Berichterstattung oft versicherheitlicht werden, also als Sicherheitsangelegenheit geframt werden. Dabei wird die Funktion von Moscheen als Orte religiöser Praxis, sozialen Beisammenseins und safe spaces aberkannt. #MeinMoscheeReport ist der Versuch, diesem Framing mit alternativen, persönlichen Geschichten entgegenzutreten und die Deutungshoheit über den Wert muslimischer Räume zurückfordern: Die Moscheedebatte neu zu (be-)greifen.
Die Kunst die neuen Schuhe nach (Cuma) dem Freitagsgebet wieder zu sehen bzw. zu finden. #MeinMoscheeReport
— Celalettin Soylu (@celsoylu) April 24, 2017
Wenn eine Moschee deiner Stadt nach Jahren merkt, dass man um etwa 30 Grad an Mekka vorbeigebetet hat. #meinmoscheereport #keinscherz
— Erdal Aslan (@era_slang) April 24, 2017
Die postkoloniale Denkerin Gayatri Spivak verwies vor 30 Jahren mit der Frage „Can the subaltern speak?“ auf die historische Exklusion von marginalisierten Gruppen aus Repräsentationsressourcen. Mittlerweile erweisen sich soziale Medien als wichtige Ressourcen für Menschen, die im medialen Mainstream vielleicht nicht mitsprechen, aber sehr wohl twittern können. Denn: The subaltern can tweet.
#HashtagIdentities: Weil es „die” Muslime noch nie gab
Eines der berühmtesten Hollywood-Zitate stammt von Don Draper in Mad Men: „Das ist nie passiert. Es wird dich schockieren, wie oft es nie passiert ist.“
Das Zitat kann genauso für Erzählungen über „die Muslime“ gelten. Denn Muslim*innen als homogenes Kollektiv ist eine Fiktion: „Die“ Muslim*innen gibt es nicht. Es ist erstaunlich, wie oft es sie noch nie gab. Twitter-Bewegungen wie #MeinMoscheeReport und #MeTwo machen die Unterschiede zwischen Menschen(gruppen), die sich mit dem Islam identifizieren, wieder sichtbar. Durch die persönlichen Berichte in den sozialen Medien werden Identitätsdebatten vielfältiger, komplexer – und die Notwendigkeit einer Differenzierung in den Medien wichtiger denn je.
Disclaimer: Die ausgewählten Tweets sind nicht repräsentativ. Sie zeigen einiges, aber nicht alles. Man kann in einem Artikel über muslimische Identitäten ohnehin nicht alles wiedergeben. Man kann sich jedoch bemühen, nicht den gröbsten Unsinn zu schreiben. Damit ist schon viel gewonnen.
¹ Wenn nachfolgend „Muslim*innen“ oder „muslimisch“ geschrieben wird, dann handelt es sich nicht um Selbstbezeichnungen oder wirkliche Attribute, sondern um politisch zugeschriebene Markierungen, die zutreffen können, aber nicht müssen.
veröffentlicht am 07.05.2020