Religions- und Wertevielfalt in pluralistischen Gesellschaften
Pluralistische Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass es in ihnen Platz für verschiedene Individuen und Gruppen gibt, deren Werte sich voneinander unterscheiden und auch mitunter konträr zueinander stehen können. Die gesellschaftliche Heterogenität ist aus historischen und gesellschaftlichen Prozessen der Säkularisierung, Ausdifferenzierung, Individualisierung sowie grenzüberschreitender internationaler Mobilität hervorgegangen.
Grundlage dafür, die verschiedenen Lebensweisen und Glaubensüberzeugungen ausüben zu können, bietet in Deutschland der weltanschaulich neutrale, demokratische Staat. Ausgangspunkt hierfür ist die Einsicht, dass über bestimmte Grundfragen der Lebensführung, denen oftmals verschiedene Werte zugrunde liegen, kein Konsens erzielt werden kann (Speth/Klein 2000).
Angesichts der verschiedenen Weltanschauungen, politischen Überzeugungen, sozioökonomischen Interessen und zum Teil kulturell bedingten Einstellungen kann das Zusammenleben dementsprechend sehr konfliktträchtig ausfallen. Sei es im Schwimmbad, wo verschiedene Wertevorstellungen und Schamgrenzen bezüglich Bademode und Umkleidevorschriften zusammenkommen, oder in heterogenen Städten und Bezirken, wo religiöse Menschen in unmittelbarer Nähe zu trinkfreudigen Barbesucher*innen leben und arbeiten. Auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist das Zusammenleben von Wertekonflikten geprägt. Gegenwärtig wird beispielsweise angesichts der Pandemie und der aus dem Lockdown für Gesellschaft und Wirtschaft entstandenen Probleme darüber debattiert, ob der Lebensschutz oder die Freiheit bei der Bekämpfung des COVID19-Viruses Vorrang hat. Diese und ähnliche elementare Wertedebatten gehören zu den Grundkontroversen heterogener Gesellschaften.
Wertekonsens um jeden Preis?
Im Streben nach Anerkennung, Deutungshoheit und Hegemonie begegnen sich bei der Aushandlung dieser Konflikte verschiedene Interessengruppen. Das politische System ist auf solche (Werte-)Konflikte[1] angelegt und bietet einen Ordnungsrahmen dafür, diese auszutragen.
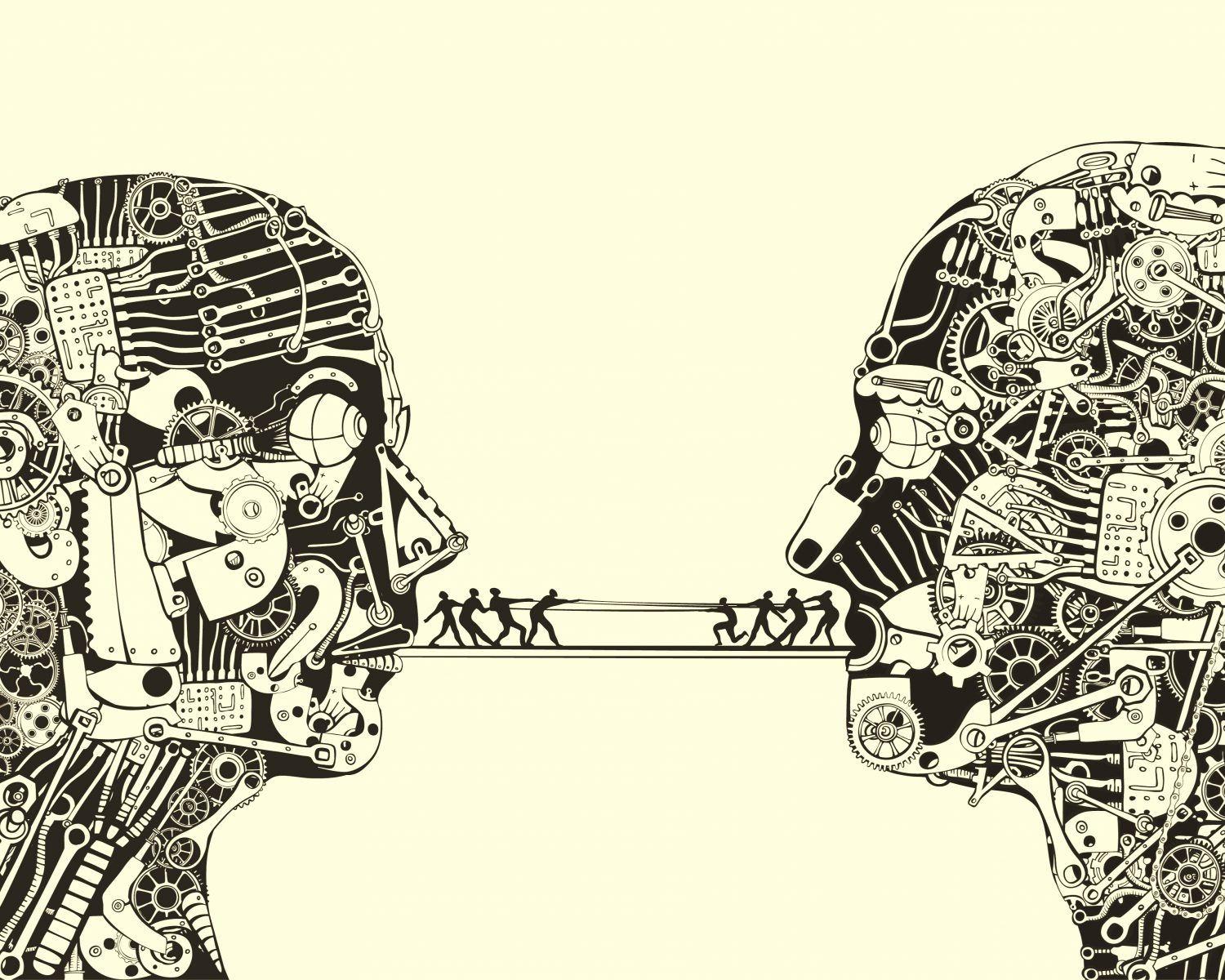
So zielen das allgemeine und gleiche Wahlrecht, politische Freiheitsrechte, das Mehrheitsprinzip oder der Minderheitenschutz darauf, verschiedene gesellschaftliche Akteur*innen gleichermaßen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubinden. Das demokratische System ist somit darauf ausgelegt, Heterogenität zu ermöglichen (Schulte 2000, S. 38–39). Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass an Wertekonflikten beteiligte Konfliktparteien ihr Gegenüber argumentativ von der Richtigkeit der eigenen Werte überzeugen können oder müssen. Das Ziel von Wertedebatten ist nicht Konsens zwischen allen Beteiligten, sondern vielmehr Koexistenz. Die Standpunkte der an den Konflikten beteiligten Akteur*innen können deswegen unversöhnlich bleiben, solange die Lebensführung der Opponent*innen akzeptiert wird (Mouffe 2007, S. 30). Das ist eine sehr wichtige Eigenart der gesellschaftlichen Verfassung der Bunderepublik, die in kontroversen Debatten teilweise vergessen wird.
Ordnungsrahmen und Verfahrensregeln, die im Grundgesetz zum Ausdruck kommen, sind in Abgrenzung zu der homogenisierenden nationalsozialistischen Ideologie und zu identitären demokratietheoretischen Vorstellungen zu verstehen, die in identitärer, ethnischer oder religiöser Homogenität die Voraussetzung für stabile Demokratien sehen (Detjen 2009, S. 18–20). Im Gegensatz dazu basiert die Bunderepublik auf einem Grundgesetz, durch das weder eine Nation noch eine Religion – verstanden als homogene Gebilde mit einheitlichen Werteorientierungen – hegemonial als gemeinschaftsbildende Institutionen gesetzt werden.
Gleichzeitig beschränkt das Grundgesetz sich nicht ausschließlich auf die Festlegung der oben beschriebenen formalen Kriterien der Staatsorganisation. Denn der Zweck der formalen Kriterien besteht darin, auf methodischer Ebene festzulegen, wie politische Entscheidungen getroffen werden können. Verfahrensgerechtigkeit reichte aber den Verfasser*innen nicht für die Etablierung einer gerechten Gesellschaftsordnung aus.
Um gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Individuen und Gruppen zu ermöglichen, ist das Grundgesetz deshalb über die formalen Kriterien hinaus auf bestimmte Werte und deren Verwirklichung ausgerichtet.
Was sind aber „unsere“ Werte?
Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen verbindlichen Wertekatalog, der alle Fragen des guten Lebens umfasst. Die Idee einer deutschen Leitkultur, wie sie von unterschiedlichen Politiker*innen seit Ende der 90er-Jahre reklamiert wird, oder die Berufung auf vermeintlich ausschließlich christliche Werte sind mit einer solchen liberalen Auslegung des Grundgesetzes unvereinbar (Speth/Klein 2000). Vielmehr sind grundlegende Werte und Normen des politischen und rechtlichen Zusammenlebens der Gesellschaftsmitglieder gezielt so gestaltet, dass sie verschiedene Lebensformen ermöglichen.
Als inhaltlicher Kern des Grundgesetzes werden deshalb die Menschenwürde als oberster Wert sowie Freiheit und Gleichheit genannt.
Der Menschenwürde liegt die universalistische und egalitäre Moral der gleichen Achtung zugrunde, wonach jede Person als gleiche und autonome Person anerkannt ist. Dadurch wird dem Autonomieprinzip eine wesentliche Position eingeräumt. Als wichtigstes moralisch gerechtfertigtes Interesse ist die Menschenwürde die Basis der Selbstbestimmung (Gosepath 1998, S. 147–178).
Meinungsverschiedenheiten gibt es darüber, ob durch die Priorisierung von Freiheit oder Gleichheit als Wert die gerechtesten Bedingungen zur Sicherung der Autonomie geschaffen seien. Debattiert wird über Gewichtung, Art und Weise der Verwirklichung und die Konsequenzen der aus der Gewichtung folgenden Hierarchisierung von Freiheit und Gleichheit.
Von liberalen Interessengruppen wird beispielsweise der Wert der Freiheit priorisiert. Folglich genießt die Sicherung politischer Freiheitsrechte Priorität. Die Teilhabe an der pluralistischen Gesellschaft ist demnach für alle Gesellschaftsmitglieder möglich, wenn alle Individuen und Gruppen gleichberechtigt an den öffentlichen Debatten, „welche den Raum für die Repräsentation von differenten Erzählungen und Identitäten“ bieten, teilhaben können (Yildiz 2000, S. 223). Egalitäre Positionen hingegen, die in Gleichheit einen vorrangigen Wert sehen, setzen sich für den gleichen Anspruch aller auf eine sozial gerechte Güterverteilung ein. Dadurch könne Freiheit überhaupt erst ermöglicht werden, argumentieren sie (Gosepath 1998, S. 147–178). Sie verweisen darauf, dass die Forderung nach gleichen Freiheitsrechten für alle mit der Gewährleistung des gleichen Wertes der Freiheit für alle einhergehen muss. Es reiche nicht, „den gleichen Schutz vor Freiheitshindernissen zu gewähren, sondern es müssen auch die gleichen Möglichkeiten zum Erreichen des Freiheitsgegenstandes geboten werden“ (ebd., S. 164). Rechtliche Freiheit, also die Genehmigung zum Handeln, ermögliche nicht tatsächliche Freiheit, also die Möglichkeit, zwischen dem Erlaubten zu wählen (ebd.).
Die bildungspolitische Debatte um Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit[2] ist beispielhaft für das Aushandeln sowie die unterschiedliche Auslegung dessen, was (hier im Bildungssystem) als gerecht angesehen wird.
Vertreter*innen herrschafts- und machtkritischer Positionen verweisen allerdings darauf, dass pluralistische Gesellschaften im Ganzen und ihre Teilsysteme – zum Beispiel Bildungseinrichtungen – Produkte bisheriger Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind. Ihr Aufbau und ihr Selbstverständnis sind infolgedessen von den Wertevorstellungen und damit auch politischen Einstellungen privilegierter Gesellschaftsmitglieder durchdrungen. Die strukturellen Probleme, die die Ausgrenzung von benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen bedingten, seien zu weitgehend und verfestigt, um das Versprechen auf die tatsächliche Inanspruchnahme von Freiheit und Gleichheit für alle umsetzen zu können.
Die Werte, die die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ausmachen, sind demnach weder religiös noch kulturell begründet. Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit als zentrale Werte zeugen sogar davon, dass der demokratische Staat seinen Bürger*innen keine bestimmte Form der Lebensführung, Religionszugehörigkeit oder der kulturellen Wertehaltungen vorschreiben kann und will. Er ist vielmehr dazu „verpflichtet und findet seine Begründung und Legitimität gerade darin, [dass] seine Bürger ungeachtet ihrer diversen Werthaltungen und Weltanschauungen“ (Ingenfeld 2009, S. 28) als solche gleich behandelt werden.
Vielmehr zeigen wertebezogene Debatten um die Priorisierung von Freiheit oder Gleichheit, wie sie an unterschiedlichen Stellen geführt werden, „dass die größte Bruchstelle in einer Gesellschaft und zwischen verschiedenen Gesellschaften weiterhin die ökonomische ist – selbst wenn soziale Konflikte immer häufiger in einem kulturellen oder religiösen Vokabular ausgedrückt werden“ (Kermani 2016, S. 25).
