Religionsfreiheit für wen? Paradoxien des säkularen Staates
Ein für den säkularen Staat wesentliches Freiheitsrecht ist die Religionsfreiheit (Art 4, 1 und 2 GG). Dennoch steht dieses Recht seit den letzten Jahrzehnten immer wieder im Mittelpunkt kontroverser Debatten. Meist dreht es sich hierbei um die Sichtbarkeit muslimischer Religiosität, wie beispielsweise der Streit um das Kopftuch der Lehrerin in Deutschland verdeutlicht. Diese Debatten stellen eine Herausforderung für den säkularen Staat dar, seinen Anspruch der Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften auf seinen Realitätsgehalt hin zu überprüfen und sich angesichts religiöser Pluralisierung dieser fundamentalen Werte zu vergewissern. Zugleich begibt sich der säkulare Staat im Rahmen dieser Debatten in einen Aushandlungsprozess über diese Werte, die mit Werten anderer Akteur*innen in Konflikt geraten und mitunter infrage gestellt werden.
Im Spannungsfeld zwischen der positiven und negativen Religionsfreiheit der Bürger*innen und der religiösen Neutralitätspflicht des Staates wird seit 2003 über die islamische Kopfbedeckung gestritten. Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27.01.2015 (1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10) wurde Pädagog*innen an staatlichen Einrichtungen durch entsprechende allgemeine Verbote in den Schulgesetzen mehrerer Bundesländer das Tragen eines Kopftuchs verboten. Die Pflicht von Beamt*innen, die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates zu wahren (Art. 33, 2 GG), so die Begründung, kollidiere mit dem Recht der Pädagog*innen auf die garantierte Glaubens- und Bekenntnisfreiheit (in Art 4, 1 und 2 GG).
Zwar wird die Religionsfreiheit laut Grundgesetz nicht uneingeschränkt gewährt, sondern kann eingeschränkt werden, wenn eine konkrete Gefährdung für die Grundrechte anderer Menschen besteht. Als Grundlage dieses allgemeinen Verbots diente jedoch die Feststellung einer pauschalen und somit „abstrakten“ Gefahr für die staatliche Neutralität oder die „negative“ Glaubensfreiheit der Schüler*innen, also ihr Recht, nicht mit Glaubensüberzeugungen bedrängt zu werden (Berghahn 2017, S. 203; Wiese 2011, S. 96). Hinzu kommt, dass, obwohl in diesen Gesetzen das Kopftuch nicht explizit genannt wird, aus ihrem Entstehungskontext sowie den Fällen, in denen sie angewandt wurden, darauf geschlossen werden kann, dass sie vornehmlich auf das Verbot des islamischen Kopftuchs zielten. Die in einigen dieser Gesetze verankerten Ausnahmeregelungen zugunsten des Christentums bestätigen die These. Dies widerspricht jedoch dem Gleichbehandlungsgrundsatz (Berghahn 2017, S. 205; Wiese 2011, S. 98). Darüber hinaus ist Deutschland kein laizistischer Staat. Die Neutralität des Staates verpflichtet ihn somit nicht dazu, religiöse Sichtbarkeit vollkommen aus der religiösen Sphäre zu entfernen. Religionsfreiheit schließt in diesem Sinne keinen generellen Schutz vor der Konfrontation mit religiösen Symbolen mit ein (Berghahn 2017, S. 194–195; Wiese 2011, S. 97).
Neutralität vs. Religionsfreiheit?
In seiner Urteilsverkündung aus dem Jahr 2015 erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Gesetze entsprechend für unzulässig. Demnach sei ein solches allgemeines Verbot des Tragens religiöser Kleidung und Symbole durch Beamt*innen angesichts der damit einhergehenden Einschränkung der Religionsfreiheit der Betroffenen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Vielmehr könne ein solches Verbot nur im Einzelfall erfolgen, wenn eine „hinreichend konkrete Gefahr der Beeinträchtigung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität“ (o.A. 2015) von der entsprechenden Person ausgehe. Damit verbunden ist auch eine Absage an die in den Schulgesetzen einiger Bundesländer in sogenannten „Ausnahmeklauseln“ festgehaltene Privilegierung von christlichen Bildungs- und Kulturwerten oder Traditionen.
Dieses Urteil stellt einen wichtigen Meilenstein für die gesellschaftliche Anerkennung und Partizipation von Muslim*innen dar. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das allgemeine Kopftuchverbot zu kippen, kann als eine klare Anerkennung des Rechtes der Betroffenen auf freie Religionsausübung am Ende eines langen Aushandlungsprozesses um das Kopftuch gedeutet werden (Foroutan 2019, S. 94–95).
Der beschriebene Aushandlungsprozess um Anerkennung und Teilhabe ist ein Beispiel dafür, wie Muslim*innen als Akteur*innen der pluralen Demokratie sichtbar geworden sind. Im Kontext einer der vielen Debatten um Fragen mit Religions- und Wertebezug wurde damit eine rechtliche Konkretisierung der bisher vor allem symbolischen Anerkennung errungen. Das zeigt deutlich, dass es sich bei als Religions- und Wertedebatten geführten Konflikten auch um die Aushandlung von Teilhaberechten handelt.
Dennoch sind gegenwärtig in Politik und Gesellschaft nach wie vor starke Tendenzen der Infragestellung oder gar Ablehnung der errungenen Rechte für Muslim*innen festzustellen (Foroutan 2019, S. 93–94). Auch auf institutioneller Ebene ist eine Zurückhaltung bei der Umsetzung des zugestandenen Rechts zu sehen.
Trotz der Empfehlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte haben es Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis heute versäumt, ihre Schulgesetze entsprechend der neuen verfassungsrechtlichen Grundsätze zu ändern.[1] Das Saarland hat bekannt gegeben, dass eine Ausnahmeklausel, die die Privilegierung christlicher und jüdischer Symbole enthält, weiterhin beibehalten werden soll. Das Neutralitätsgesetz in Berlin verwehrt es allen Beamt*innen (Lehrkräften, Richter*innen, Polizeibeamt*innen etc.), religiöse und weltanschauliche Kleidungsstücke und Symbole zu tragen (Berghahn 2019, S. 245–248).
Bis heute ist der Kopftuchstreit von der Unterstellung gekennzeichnet, dass Frauen, die sich für das Tragen eines Kopftuchs entscheiden, per se gegen Grundwerte der Demokratie und Rechtstaatlichkeit verstoßen (Berghahn 2017, S. 204).
Wie religiös neutral ist der säkulare Staat?
Diese Aushandlung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit sowie der Neutralitätspflicht des Staates stellt einen Aspekt der Kopftuchdebatte neben anderen dar. Dabei wird deutlich, dass es keine eindeutige Lösung gibt, sondern dass die Gewichtung der einzelnen Werte immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Die einseitige Fokussierung auf die Sichtbarkeit muslimischer Religiosität weist dabei auf einen inhärenten Widerspruch innerhalb der Debatte hin: Denn es geht hier um die Aushandlung eines Rechts, das durch die Werte der pluralen Demokratie und durch das Grundgesetz eigentlich gewährleistet sein sollte, jedoch wird es einzelnen Bevölkerungsgruppen schwieriger gemacht, dieses einzufordern. Trotzdem kommt es in der Debatte zu erheblichen Spannungen zwischen denjenigen, die dieses Recht einfordern, und denjenigen, die darin eine Gefährdung für unser Wertefundament sehen (Foroutan 2019, S. 95). Was hier durchscheint, ist, dass letztlich eine Homogenität der äußeren Erscheinung gefordert wird: Man muss dem säkularen Habitus und der Norm, dass das Religiöse ins Private und Unsichtbare gedrängt wird, sowie den „modernen“ Geschlechtervorstellungen entsprechen. Die säkularen Idealvorstellungen werden dabei als selbstverständlich und universell vorausgesetzt und mit der religiösen Neutralität des Staates legitimiert (Berghahn 2017, S. 208).
Dabei zeigt sich, dass der moderne Säkularismus keinesfalls eine religionsneutrale und wertfreie Basis darstellt. Im Gegenteil ist er höchst voraussetzungsreich, z.B. im Hinblick auf die Vorstellung der Organisation von sozialem, politischem und religiösem Leben (Mahmood 2016, S. 2–3). Zu sehen ist das auch daran, dass die Anerkennung einer Religionsgemeinschaft an bestimmte Bedingungen geknüpft wird. Der Anerkennungsprozess wirkt sich dann auch auf die Muslim*innen aus, z.B. auf ihre Organisationsformen oder ihre religiöse Praxis. Der säkulare Staat zeigt damit ein bestimmtes Religionsverständnis, das stark vom (protestantischen) Christentum geprägt ist.[2]
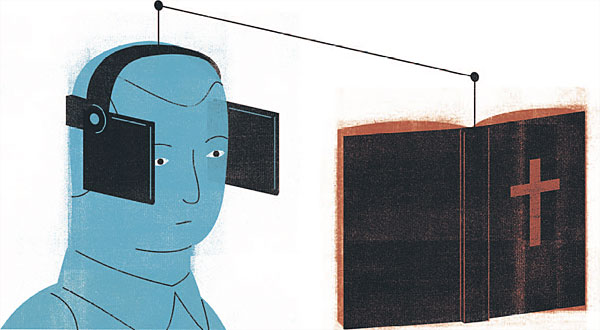
Es besteht ein vorgegebenes Arrangement von Staat und Kirche, das eine Art Gerüst darstellt, in das sich Religionsgemeinschaften einfügen müssen.
Säkulare Werte geben somit den Rahmen vor, innerhalb dessen über die (Un-)Zulässigkeit von Religiosität im säkularen Staat verhandelt wird (Amir-Moazami 2016, S. 121–126).
Die Frage nach dem Geltungsbereich von Religionsfreiheit in pluralistischen Gesellschaften und danach, wann und unter welchen Umständen sie eingeschränkt werden darf oder sollte, wird damit zu einer komplexen Angelegenheit: Verschiedene Werte müssen gegeneinander abgewogen und Strukturen sowie als selbstverständlich erachtete Grundlegungen reflektiert und überprüft werden, um die Gleichbehandlung aller Bürger*innen mit ihren verschiedenen Religionszugehörigkeiten gewährleisten zu können. Die Kontroversen um Religionsfreiheit zeigen zudem, dass Grundrechte in der pluralistischen Gesellschaft nicht immer klar bestimmbar sind und es letztlich darum geht, die jeweiligen Geltungsbereiche und -ansprüche auszuhandeln.
